
Rita Kiehnbaum

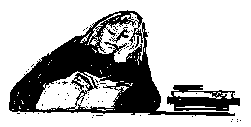 Gedanken beim Lesen eines Buches
Gedanken beim Lesen eines Buches
KONRAD WOLF: DIREKT IN KOPF UND HERZ
Das Motto, das dem Text vorangestellt ist, macht mir den Autor vertraut
als wäre es mein Bruder.
Es ist zweisprachig und lautet in der Übersetzung so:
VERSÄUM NICHT: RUH NICHT! SCHAFFE!
TU DEINE ARBEIT GERN
UND KÄMPFE MIT DEM SCHLAFE
DEM FLIEGER GLEICH,
DEM STERN
Es ist ein Vers von Pasternak.
Konrad Wolf hat sehr früh in den Krieg müssen, kam heil in die Trümmerwüste Berlin, in ein Land zurück, das noch lange nicht seine Heimat war. Hatte es doch seine Eltern vertrieben. Die Troika von Peredelkino, seine liebe, tapfere Mutter, alle die Freunde dort bei Moskau und die Mütter der Freunde - das war seine Heimat. Dann, nach Jahren der Arbeit, der Entdeckungen und Erfahrungen hatte er plötzlich zwei Heimatländer, beherrschte zwei Sprachen. Dieses Privileg konnte leider -so unreif, so voller Vorurteil und Feindschaft waren die Menschen damals (sind sie es nicht leider noch ?) jederzeit in ein Handicap umschlagen. Dann hieß - und sei es hinter vorgehaltener Hand - entweder FRITZ oder VATERLANDSVERRÄTER. Konrad Wolf hat, wie jeder, der sein Bestes gibt, unter Kälte und Ungerechtigkeit sehr gelitten.
Von seinen Filmen sah ich drei : "Sterne", "Der geteilte Himmel"
und "Goya".
Bei "STERNE" merkt man, was für ein junger Mensch sein Regisseur
war. Es ist aber ein richtiger, ein sauberer Film, der Wesentliches sagt
und zeigt.
DER GETEILTE HIMMEL entsprach Christa Wolfs Buch und unseren eigenen
Gefühlen und Überzeugungen in Idealbesetzung.
Das war damals (und ist es sicher heute noch) ein großer Film.
Als Meisterleistung habe ich sofort GOYA empfunden.
Wiederum Idealbesetzung und Idealverfilmung eines literarischen
Stoffes. Mein erstes Erlebnis eines wirklichen FARBFILMS. Kein buntes Chaos
sondern wirkliche Arbeit mit dem Medium Farbe. Von überwältigender
Einfachheit und Raffinesse.
Der rote Rock, den die Alba fallen läßt, durchlodert
noch immer das Universum der Leidenschaft.
Der arge Weg der Erkenntnis des großen Goya als Gleichnis.
Die Versuchungen der Macht. Ihre Grenzen.
Die Wahrheit.
Der Preis, den man zahlt.
THOMAS WOLFE: SCHAU HEIMWÄRTS, ENGEL!
Mir, die ich die dramatische Wucht kurzer Prosa bewundere, kommt
sein umfangreiches Buch (wieviele Wörter? - "Soviele Wörter wie
Tom Wolfe hab ich nicht", schreibt Hemingway), wie eine Riesensammlung
unerlöster short-stories vor, die alle um das gleiche Thema kreisen:
Identitätssuche und Heimverlangen. Die Briefe offenbaren das altbekannte
Elend, Abhängigkeit vom Verleger, die ewig unsichere ökonomische
Situation trotz harter Arbeit, die künstlerischen Zweifel.
Die stille Tapferkeit im Schatten des zu frühen Todes. Spontane
Zuneigung zu ihm aber besonders wegen seiner Zeilen über Deutschland,
dessen Kultur er liebt und wo er über Rowohlt eine Lesergemeinschaft
gefunden hat. Nicht geblendet durch Lob und Freundlichkeit schreibt er
zur Zeit der Olympischen Spiele eine Karte mit folgendem kurzen Text aus
Berlin nach Hause: "Diese Jungs können verdammt gut marschieren, und
es sieht aus, als ob sie bald wieder losschlagen wollen."
Welche klarsichtige Schlußfolgerung, wo so viele blind und
taub waren! Sie erinnert mich z.B. an das was Joseph Roth, 1928 im Kreis
seines Verlegers S. Fischer verzweifelt lächelnd sagte: "In 10 Jahren
wird a) Deutschland gegen Frankreich Krieg führen b) werden wir, wenn
wir Glück haben, als Emigranten in der Schweiz leben, c) werden die
Juden auf dem Kurfürstendamm geprügelt werden." Niemand glaubte
ihm damals.
Der Franzose Pierre Bertaux hat diese Sätze in seinen Erinnerungen
bewahrt. Das sei ihm nicht vergessen. Ein inniges Gefühl von Dankbarkeit
gibt meinem Verlangen neue Nahrung, dieser internationalen geschwisterlichen
Welt anzugehören.
"Denn diese Menschen sehen was die andern nicht sehen... Die Gabe
des Sehens, des Staunens ist eine den Dichtern vorbehaltene." (P. Bertaux
1970 vor der Akademie der Künste der DDR in seiner Gedächtnisrede
auf Heinrich Mann.)
Thomas Wolfe: Schau heimwärts, Engel. Rowohlt Verlag 1995, 712
S.; 16,90; derselbe: Briefe. Rowohlt Verlag 1987, 623 S., DM 42,--.
ANDZEJ SZCZYPIORSKI: SELBSTPORTRÄT MIT FRAU
Wem tue ich nur dieses zum Wegschmeißen zu teure Buch als Geschenk
an? Hätte ich es doch bei der aufregend geschriebenen Rezension von
Hermann Kant und meinen sofort geäußerten düsteren Ahnungen
belassen!
Besonders der letzte Abschnitt der Rezension (ND vom 7.10.94) erschien
mir wie die bestmögliche Kennzeichnung von Kants eigener Erzählweise
und verführte mich, die sechsunddreißig Mark für das beim
DIOGENES VERLAG in Zürich erschienene Werk hinzublättern.
Was hilft es mir jetzt, daß ich die Geschichte selbst las?
Daß ich anfangs meinen begründeten Widerwillen fast vergaß,
von Seite 20 ab, durch "das Gespräch mit dem Geheimen ", die kenntnisreiche,
meisterhafte Beschreibung der geschilderten Situation vom Lesevergnügen
regelrecht geschüttelt wurde? Mindestens ab Seite 41, von "Eigentlich
bin ich doch ein schrecklicher Flegel" an, hätte ich nach dem dazugehörenden
Abschnitt das Buch zuklappen müssen.
Die Gedanken, die an dieser Stelle geäußert werden, als
Männerphantasien und das, was - ein paar Seiten später - die
Horde Kerle wehrlosen Frauen antut, fast mitleidig als Verwilderung zu
bezeichnen, erscheint mir als eine erstaunliche Abwiegelung.
Wer davon absehen kann, dem begegnen in diesem Buch viele, mit großer
Erzählkunst formulierte Details.
Kant nennt z. B. unter anderem, "daß die Regierungsverfahrensweise
eines Riesenreiches nicht einem kleinen Land übergestülpt werden
darf."
Ich würde z.B. die Gefängnisbesuche als unvergeßlich
geschildert hervorheben und die im Urgrund damit verbundene zerknirschte
Sehnsucht nach Erlösung durch wirkliche Liebe, die der Hauptheld,
so schwant es ihm ganz richtig, nicht wert ist - trauriger Antikommunist,
zu dem er wurde, möglicherweise mit dem schlauen Gedanken im Hinterkopf,
daß derlei Verwandlung jetzt günstigen Markt hat.
Hätte ich es beim Lesen der Rezension von Hermann Kant und
bei meinen düsteren Ahnungen belassen!
Wem tue ich nun dieses zum Wegschmeißen zu teure Buch als
Geschenk an?
Andzej Szczypiorski: Selbstporträt mit Frau. Diogenes Verlag, Zürich 1994.
PETER HØEG: DER PLAN VON DER ABSCHAFFUNG DES DUNKELS
Der dänische Autor stellt eine Gruppe blutjunger Menschen gegen
die dämonische, allumfassende, grausame offensichtliche und geheime
Macht des kapitalistischen Staates und seine sich demokratisch gebärdenden
Auswahl- und Erziehungsmethoden.
Keine Frage, auf welche Seite des ungleichen Kampfes der Autor uns
mitnimmt. Es ist seine. Und dies ist die Laudatio für alles, was ich
bisher von diesem Menschen las:
PETER HØEGDer an die Tür pocht
Sein beharrliches Muster
Der pocht
Bis du wach bistDer übers Eis geht
In die finstere Kälte
Unaufhaltsames Wesen:
Der Mensch
Der nicht aufgibtDer Mann aus dem Norden
Mit dem freundlichen Lächeln
Mit der Hoffnung im Herzen
Mit dem Kind an der HandEr pocht an die Türen
Sein beharrliches Muster
Damit wir uns sammeln
Einander zu helfen
Die Liebe zu retten
Die Erde
Das Licht
Peter Høeg: Der Plan von der Abschaffung des Dunkels. Hanser-Verlag München/Wien 1995, 291 S., DM 39,90.
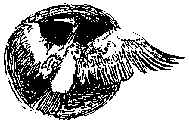 HERMANN KANT: KORMORAN
HERMANN KANT: KORMORAN
Manchmal heißen sehr sanfte Menschen Blechschmitt. Dieser hier
wird vom Erzähler KORMORAN genannt. Man muß nicht in Brehms
TIERLEBEN nachsehn: Den entsprechenden Passus liefert der Autor gleich
mit. Außerdem ist dieser seltsame Vogel, der sich sowohl im Wasser
als auch in der Luft sicher zu bewegen weiß, durch die futterneidischen
Flüche seiner Kollegen Fischer ins öffentliche Gerede gekommen.
Kormoran also. Paul-Martin dazu. Na, horch und guck!
Wer das Gedröhn in den gesamtdeutschen Gazetten verfolgte,
schlägt dieses Buch vielleicht mit speziellen Erwartungen auf - und
empfängt eine Lehre. Die nämlich, daß dieser Autor gar
nicht daran denkt, unser uns selbstverständlich erscheinendes Abonnement
auf seinen scharfen Witz und darauf, daß er unsre unersättliche
Vergnügungssucht stillt, zu bedienen, daß er Kastanien für
uns aus dem Feuer holt oder auf dem Hochseil über reißende Fluten
radelt. Nichts von dem. Und doch alles darüber.
Es ist trotz angemessen beschriebener Betriebsamkeit eine stille
Geschichte, wie sie mehr oder weniger uns allen jährlich passiert.
Wenn wir Glück haben. Meist sind wir hinterher noch da. Was man von
Paul-Martin Kormoran nicht behaupten kann nach dem Geburtstag, von dem
hier erzählt wird.
Dabei hatte alles so gut angefangen! Man gab sich die erdenklichste
Mühe, dem Tag Heiteres abzugewinnen. Dankbarkeit vielleicht, Zukunftshoffnung
sogar! Die Änne, die Ilse, die Ruth, der Herbert, Schwägerinnen,
Schwager, Freunde und Bekannte; nicht zu vergessen - Gotte, ne- die Nachbarin
am Zaun und Kormoran selbst. Unvergeßlich, obwohl milde belächelt,
die AGITKA HEIMATLOSE LINKE mit dem auf den neuesten Stand gebrachten Lied
von Pastuur Gauck sien Kauh! Unvergeßlich die Änne, Ehefrau
des Paul-Martin, praktizierende Ärztin, ausreichend aufgeklärt
und illusionslos also, die, um ihren Mann zu retten, auch einen Schamanen
um Hilfe gebeten hätte. Unvergeßlich dieser ordinäre Stinkstiefel
von Schwager, der, nach dem Fortgang der Geschichte fragend, die der Schriftsteller
gerade in Arbeit hat, eine gloriose Zusammenfassung aktuellen Geschehens
gibt, die richtig bleibt, obwohl keiner mehr hört. Denn Paul ist tot.
Diese Geschichte sollte ein Bühnenstück werden, wird uns
verraten. Auch, warum daraus nichts wurde. Weil aber ein reizvoller Gedanke
ein reizvoller Gedanke ist, läßt der Autor mal zwischendurch
einen imaginären Vorhang fallen und berichtet z.B. von einer unglücklichen
Liebe, die mich sehr erheiterte.
Sodaß - ob vor oder hinter dem Vorhang - sich letzten Endes
der Autor doch als der zu erkennen gibt, der uns vertraut ist, auf dessen
Beistand, auf dessen Aufrichtigkeit wir rechnen, mit dem wir trauern und
mit dem wir - immer noch und trotz allem - lachen können.
Salut, Kant!
MEJA MWANGI: TÖDLICHE FREUNDSCHAFT
Mir ist ein Kinderbuch vor die Augen gekommen, das hat Meja Mwangi
geschrieben. Er wurde 1948 geboren und wuchs zur Zeit der Mau-Mau-Aufstände
in Kenia auf. Heute, so sagt der Buchumschlag, ist Mwangi einer der bekanntesten
Autoren des Landes. Seine Romane und Kinderbücher wurden in zehn Sprachen
übersetzt und in Deutschland, Großbritannien und Kenia mit zahlreichen
Literaturpreisen ausgezeichnet. Dieses Buch heißt KARIUKI und hat
den Jugendliteraturpreis verdient erhalten. Es erzählt von der verbotenen
Freundschaft zweier Jungen. Der eine, Kariuki, gehört mit seiner Familie
zum Gesinde des weißen Farmers "BWANA" Ruin, eines furchteinflößenden
Riesen, bärenstark, mit grünen Augen, mit denen er, so sagt man,
auch nachts sehen kann, auch den Leuten ins Herz, um jede Lüge zu
entdecken. Durch die Hautfarbe Jesus verwandt - also Gott ähnlich.
Allmächtig. Der andere Junge, Nigel, ist aus England gekommen, um
"BWANA" Ruin, seinen Großvater zu besuchen.
Es sind Ferien. Kariuki weiß nicht recht, ob er sich freuen
soll, dem grausamen Hohlkopf von Lehrer für eine Weile entronnen zu
sein, denn zu Hause wartet schon seine gestrenge Mutter mit ihrer endlosen
Liste von Aufträgen - - - So zieht er seinen Heimweg in die Länge
und trifft am Staubecken des Flusses unter den alten Bäumen Nigel
mit seiner Angelausrüstung.
Die verfitzte Schnur ergibt die erste Gelegenheit, den streng verbotenen
Kontakt aufzunehmen, der für beide Seiten fröhlich, spannend,
lehrreich, zum Schluß lebensbedrohlich, aber zwischen den beiden
Jungen zu einer echten Freundschaft wird. Nigel beginnt, barfuß zu
laufen und zum Staunen der versammelten Dörfler und zum Entsetzen
von Kariukis Vater Maisbrei zu essen. Kariuki stolziert vor der Hütte
in Nigels Lederschuhen herum.
Jungs, heißt es in dem Buch, merken immer zuerst, wenn etwas
nicht stimmt - aber sie kennen und beachten die Gründe nicht. Daß
der Vater als Koch beim Farmer und dessen Frau sich von dieser ohrfeigen
lassen muß, weil mal etwas in der Küche nicht rechtzeitig fertig
wurde, jederzeit fortgejagt werden kann und die ganze Familie dem Hunger
preisgegeben wäre, erkennt Kariuki weniger. Er kennt seinen Vater
vor allem als streng, hört wie er sich nachts schlaflos stöhnend
herumwälzt, wie er gegen die Ungerechtigkeit flucht und fürchtet
sich vor seiner ohnmächtigen Prügel.
So verspricht er seinem Vater, nicht mehr mit "dem kleinen weißen
Mann" herumzutoben und tut zwei Minuten später genau das Verbotene.
Beide Jungen jagen, fischen, rennen zusammen immer tiefer in den Wald.
Sie haben eine abenteuerliche Begegnung mit "OLD MOSES", dem gewitzten
Warzenschwein und dann ist plötzlich auf einem ihrer Streifzüge
Nigel verschwunden. Kariuki sucht verzweifelt nach ihm, wird dabei aber
nur zur zweiten Geisel der MAU-MAU.
Hari, großer Bruder, von dem Kariuki alles gelernt hat, was
er weiß, mit den Waldkriegern in Verbindung, rettet die beiden Kinder
und bezahlt dafür mit dem Leben.
Die Geschichte verliert bis zum bitteren Schluß nichts von
ihrer freundlichen Sachlichkeit. Sie macht uns herzzerreißend still
die Zusammenhänge zwischen Recht und Unrecht klar. Auch, daß
Freundschaft und Liebe, sich über alle Verbote hinwegsetzend, mitten
in der Gefahr nicht nach dem Preis fragt. Daß sie der einzige menschliche
Grund sind zum Leben und zum Kampf um Gerechtigkeit.
Wir hatten in unserem kleinen Land DDR viele gute Bücher und
Kinderbuchschreiber. Ich mußte beim Lesen von KARIUKI an zwei von
ihnen denken - an Geschichten, die wir sehr liebten und lieben, wie zum
Beispiel "Der Neger Nobi" und "Herniu und Asni" von Ludwig Renn und an
"Heinrich verkauft Friedrich an den fremden Herrn" von Uwe Kant. Uwe Kant
hatte im Mai Geburtstag. Nachträglich die herzlichsten Wünsche
für Gesundheit und Schaffen! Dank den Übersetzern und dem Lamuv
Verlag Göttingen, daß sie uns mit Meja Mwangi bekannt gemacht
haben, der im Nachwort schreibt: "Während der Zeit des Ausnahmezustandes
aufzuwachsen, war eine grauenhafte Erfahrung für ein siebenjähriges
Kind ... Auch wenn "Kariuki" in meiner Heimatstadt spielt, ist es nicht
meine eigene Geschichte. Aber sie stammt aus einer Gegend, die meinem Herzen
sehr nahe ist."
Meja Mwangi: Kariuki und sein weißer Freund. Eine Erzählung
aus Kenia. Aus dem Englischen von Jürgen Martini und Helmi Martini-Honus.
Lamuv Verlag GmbH Göttingen 1996, 157 S.
 GÜNTER GRASS: EIN WEITES FELD.
GÜNTER GRASS: EIN WEITES FELD.
Wen eine Stadt wie Berlin mit ihrem speziellen Schicksal nicht kalt
läßt, wer die Romane, Geschichten, Theaterkritiken und Reiseberichte
von Theodor Fontane sehr mag, wer möchte, daß es in den deutsch-deutschen
Beziehungen endlich wieder zu Sachverstand und auf dieser Grundlage vielleicht
gar zu Achtung und Sympathie kommt, wen es darüber hinaus nach Liebe
verlangt, hier hat er 781 Seiten voll davon!
Man sollte sie auf der Stelle zur Pflichtlektüre mindestens
aller Mitarbeiter der Gauck-Behörde machen - die gefällige Kenntnisnahme
der Lebensumstände Fontanes mit eingeschlossen: Den ungeliebten Apothekerberuf,
dem er sich schon frühzeitig zu entziehen versuchte, das verzweifelte
Streben danach, als Schriftsteller freischaffend arbeiten zu dürfen,
ohne sich und seine Familie in Armut und Schande zu stürzen. Wie dieser
Mann deshalb immer wieder nach einigermaßen ehrenvollen Geldquellen
umherjagte, im diplomatischen Dienst des preußischen Staates England
und Schottland bereiste, bei der stockreaktionären "Kreuz"-Zeitung
eine gut bezahlte Stellung als Journalist annahm (diese, als die Zeit endlich
gekommen war erleichtert aufatmend verließ), in Frankreich während
der Ausübung seiner Tätigkeit beinahe als Spion erschossen wurde
und trotz allem sein großes dichterisches Werk wachsen ließ,
dem man sich nicht entziehen kann, das man lieben muß, wenn man es
kennt.
Mit diesem Dichter wandern wir nun nach dem Mauerfall durch Berlin.
Günter Grass ist es erstaunlich gut gelungen, den richtigen Tonfall
zu treffen, die Zeitverschiebungen und -Überlagerungen zugleich sichtbar
und vergessen zu machen.
Fontane heißt in seiner Geschichte WUTTKE, wird aber von allen
echten und unechten Vertrauten FONTY gerufen. Der Humor, die Melancholie,
die hilf- und ratlose Trauer, die Lebens-, Schau- und Beobachtungsfreude,
das wache Registrieren der gesellschaftlichen Schwächen --- das alles
ist so spannend, leicht lesbar und freundlich erzählt, daß man
die ganze Geschichte des Fontane nicht nur als hochaktuell empfindet, sondern
fast mit Sicherheit weiß: Dieser hier muß früher oder
später vor die unheilig-diensteifrige Behörde, die ihm zwar nicht
das Wasser reichen, aber veranlassen kann, daß er als "zwielichtige
Person" vor eine Untersuchungskommission gestellt wird. "Leute", so ist
die Botschaft dieses Buches von Grass, "es ist aberwitzig! Hört endlich
auf damit!"
So weit, so gut! Was die Ignoranz und den in vierzig Jahren gezüchteten
metaphysischen Hochmut in den alten Bundesländern und seine diensteifrigen
Anhänger allerorts, die Auseinandersetzung mit den allein in ihre
persönliche Macht Verknallten betrifft, ist das vollkommen richtig
und verdienstvoll, aber der eilig geschluckte, zerdrückte, aus Arbeit
und Sicherheit, aus kostenloser medizinischer Betreuung und reichen Bildungsmöglichkeiten
entlassene Rest sieht -bedingt durch die qualitativ völlig neue Entwicklung
nach dem Ende des Faschismus- Einiges etwas anders. Was sich uns darbietet
als DEMOKRATIE, reimt sich nur auf .......! Dieter Süverkrüp
sang es uns schon vor Jahren. Mit gesamtdeutscher Küsserei und gegenseitiger
Achtung werden wir wohl noch solange warten, wie wir Angst um unsere Arbeit,
unser Selbstwertgefühl und um unsere Kinder haben müssen. Da
hilft kein melancholisch-liebevolles Grienen und kein noch so flott geschriebenes,
kenntnisreiches Buch.
Sorry, Grass! Der Regen fließt nicht nach oben.
GÜNTER GRASS: EIN WEITES FELD. Steidl Verlag, Göttingen
1995, 784 S., 49,80 DM
STEFAN HEYM: EIN DICKER ROMAN. KEIN GROSSER.
Woran erkennt man die Größe eines historischen Romans?
Daran, daß jemand jahrelang Recherchen gemacht hat? Daran, daß
er es danach auf 600 Seiten brachte? Oder woran noch? Stefan Heyms RADEK
ist für mich jedenfalls eine einzige Enttäuschung. Was dort an
"Objektivität" geboten wird, gleicht bestenfalls einer durch das Bewußtsein
Heyms gebrochenen Indiziensammlung, die sich wie eine triviale Brühe
über die handelnden Personen ergießt, sie offensichtlich landläufig,
gewöhnlich, klein und beliebig machen soll, und genau das waren die
wichtigsten der handelnden Personen eben nicht. Keine Mitläufer, keine
Unüberlegten, keine Feiglinge, keine Pöstchenjäger, keine
verwaschenen Zauderer. Mit großer Entschlossenheit hatten sie sich
aufgemacht, der himmelschreienden Ungerechtigkeit des Zarenregimes in ihrem
Land ein Ende zu setzen. Frauen und Männer, eine verschworene Gemeinschaft
zu diesem Ziel. Was da über Inessa Armand, Lenin und Nadjeshda Krupskaja
im RADEK suggeriert wird, entspricht sicher der Vorstellung des Schreibers,
aber wohl kaum den Tatsachen. Inez Armand hatte sich aus tiefster Überzeugung
für den politischen Kampf entschieden und sich deshalb von ihrem Mann
und ihren fünf Kindern trennen müssen. Einer solchen Frau steht
ganz sicher nicht der Sinn nach irgendwelchen billigen, verwaschenen, schmuddeligen
ménages à trois, wie in kapitalistischen bürgerlichen
Kreisen der Langeweile und des Überdrusses üblich. Ich empfehle
allen, denen der Sinn nach Wahrheit steht, das Buch von Pawel Podljaschuk
INESSA (Dietz Verlag, Berlin 1987) zu lesen, um mit dieser Frau nähere
Bekanntschaft machen, ihr Umfeld, ihre Gedanken, ihren Weg, ihre Größe
kennenlernen zu können. Gleichfalls empfehle ich folgende Quelle:
Familie Uljanow, Dietz Verlag, Berlin 1988. Dem Heym ist offenbar bei seinen
jahrelangen Recherchen das Bild der zarten, lieblichen Nadja von einst,
das man nur mit Rührung betrachten kann, völlig entgangen. Würde
er sonst von der "höchst unerotischen" Krupskaja reden? In welchem
Etablissement, ist die unwillkürliche Frage, hat sich dieser flotte,
runde, vergnügte ehemalige Sergeant sein Wissen über Eros geholt
und bis in sein doch inzwischen hohes Alter zum Maß aller Dinge gemacht?
Nichts, was ihn inzwischen erleuchtete und eines Besseren belehrte? Keine
Erfahrungen mit wirklicher Freundschaft? Mit lebenslanger, begründeter
Zuneigung? Mit den Schwierigkeiten menschlicher Beziehungen? Im Lexikon
des Lebens nur bis Schmierigkeit gekommen? Und uns einen 600 Seiten langen
Absud davon als Trank der Erkenntnis reichen wollen? Daß Nadjeshda
Krupskaja durch die Belastungen des Alltags in den Zeiten der Emigration
an einer Krankheit zu leiden begann, die besonders sensible, kluge Personen
befällt (man kann darüber bei Morbus Basedow nachlesen!) und
gegen die es damals kein Mittel gab, zumal die täglichen Belastungen
nicht geringer wurden, ist für Heym ein zusätzlicher Anlaß,
"objektive Betrachtungen" über ihre hervorquellenden Augen zu machen.
Nicht viel Worte über ihre Tapferkeit, ihren Mut, ihre Treue, ihre
schlichte Unterordnung unter die Forderungen des Tages, sonst doch Eigenschaften,
die an Frauen, besonders an Ehefrauen, von allen Männern geschätzt
werden, ich vermute, auch von Heym, für den Hausgebrauch. Daß
Nadjeshda Krupskaja, als die Gruppe ausreisen durfte, eine Erklärung
als "Frau Lenin" unterschrieb, hält Heym für feierlich.
Sieht gar nicht, trotz jahrelanger Recherchen, daß es für europäisches
Familienbesitzdenken das Einfachste, Einleuchtendste war, so zu unterschreiben.
Das taktisch Klügste, um lästigen Nachfragen aus dem Weg zu gehen.
Ich hatte keine Lust, so ohne Weiteres einen halben Hunderter hinzublättern,
obwohl ich sonst bei Büchern unserer Schriftsteller immer noch trotz
der neuen Preise in den alten DDR-Lese- und Kaufleichtsinn verfalle. Aber
ich konnte Zuflucht nehmen zum Vorabdruck der "Berliner Zeitung". Dort
stieß ich gleich auf den neuralgischen Punkt, auf das Verhältnis
zwischen Mann und Frau und damit auf die Schwächen der HEYMARBEIT.
Zum Beispiel die Stelle, wo er das "Genie aus fremden Landen" und die zwei
Rosas auftreten läßt. Die eine Rosa, die berühmte, muß
immer nach Leo Jogiches schreien, weil sie sonst friert und kein warmes
Bett hat. Die andere Rosa, die Assistenzärztin, verschafft dem mittellosen
Radek durch ihre Arbeit Geld, gestopfte Socken und - selbstverständlich
- ein warmes Bett. Mit dem Geld der für ihn arbeitenden Rosa schwirrt
er ab zur dringend notwendigen politischen Arbeit in die Schweiz und beinahe
auf der Stelle einer reizenden, russisch-italienischen Genossin, der Balabanoff,
an den Hals, kann sich mit einem Rest schlechten Gewissens und folgender
ergreifender Überlegung aber gerade noch bremsen, trotz des sinnlichen
Mundes der Balabanoff und der Strähne, "die ihr verlockend über
die gewölbte Stirn fiel": "Nein, diese lieber nicht, von der lassen
wir unsere Finger, diese ist nur auf die eigene Person fixiert und ihre
Haupbeschäftigung ist, sich selbst zu verwirklichen, was bei Tag angehen
mochte, aber sich des Nachts als lästig erweisen würde ..." (sic!)
In dieser BILD-Qualität geht es seitenlang. Man könnte lachend
abwinken. Man könnte auch bekümmert denken: "Armer Kerl! Er schaffts
nicht mehr und bleibt deshalb unter seinen Möglichkeiten." Wenn die
Machart dieses Buches nicht so etwas Bösartiges, so etwas durch und
durch Verfälschendes hätte! Etwas, was der historischen Wahrheit
- trotz der gesammelten Details - eben nicht entspricht, im Bewußtsein
der Leser aber kleben bleibt. Ein großer historischer Roman? Ein
dicker. Zum heutigen Markt passend. Getreu dem alten Motto: Geld stinkt
nicht. Diesem ebenso traurigen wie nicht ganz neuen Vorgang "verdanken"
wir - gemessen am Gegenstand und Anspruch - die bisher schwächste
HEYM-Arbeit. Wo bleiben eigentlich die "gelernten" Literaturkritiker mit
dem längst fälligen Verriß? Sind sie inzwischen alle -
täglich kündbar - bei der Firma "Des Kaisers neue Kleider" beschäftigt?
Stefan Heym: RADEK. Bertelsmann 1995, 600 S., 49,80 DM.
EBERHARD PANITZ: EIN MANN GIBT ANTWORT
Eberhard Panitz, seit 1959 als freischaffender Schriftsteller in
der DDR bekannt geworden durch Bücher über eigenwillige Frauen,
zum Beispiel auch biographische Berichte über Katja Niederkirchner
und Tamara Bunke, gibt in seinem neuesten Buch einem liberalen, vielseitig
interessierten Juristen und Staatsbeamten aus den alten Bundesländern
freimütig Auskunft über sein ganzes Leben: Über Herkunft,
Ausbildung, Vater, Mutter, Freundin, Frau, Kind und Privilegien.
Jeder, der in den Zustand gerät, sich solchen "Gute-Onkel-Fragen"
stellen zu müssen und sich nicht einmal die friedlichste Variante
leisten kann, den bestenfalls höflich-penetranten Befrager einfach
stehen zu lassen, sollte sich das Buch von Panitz kaufen, als Anregung,
wie man Ruhe bewahrt und antwortet und antwortet und antwortet ...Ob der
gute Westonkel leicht tadelt oder lobt, ob ihm manchmal etwas dämmert
oder ob er gar nichts kapiert, verzage nicht, Ostmensch! Antworte!
Auch wenn es zum Auswachsen ist: Es dient dem Zusammenwachsen! Antworte
also! Panitz läßt seinen Herrn O. genau das tun. Er behält
die Ruhe. Läßt nichts unbeleuchtet von der Wiege an. Er erklärt,
stellt richtig, sich sogar manchmal etwas quer, aber behält immer
seine Ruhe. Das Gute daran: Er hat nichts zu verbergen. Nach so vielen
richtig braven Antworten möchte man sagen: Leider! Und im Liebling-Kreuzberg-Ton
gegenfragen: "Wat nu? Kann ick mich nu wieder anziehn? Ick krieje nämlich
sonst 'n Schnupfen!"
Aber als Leitfaden für in Befragungsnot geratene, verunsicherte
Ost-Seelen ist das "Verhör im Café" (immer noch) verdienstvoll.
Eberhard Panitz: Verhör im Café. GNN-Verlag Schkeuditz
1996, 198 S., 19,80 DM.

"UND WENN DIE WELT VOLL TEUFEL WÄR" oder: welche Bilder Landgrafs Buch über Martin Luther in mir wach gerufen hat
Die Erde im Mansfelder Land ist rot. Ich kam von der Ostseeküste in diese Gegend, um mich hier einer notwendig gewordenen Trennung mit damals noch nicht absehbaren, verheerenden Folgen zu unterziehen, ließ vom Abteilfenster aus die mittelalterlich anschaulichen Stationsnamen auf mich wirken: Teutschenthal ... Wanzleben ... Erdeborn ... Helfta ... und dann traf es mich plötzlich wie ein Schock. Ich nahm die Farbe der Erde wahr. So hatte ich sie noch nie gesehen. Sie war rot. Ein unvergeßlicher Anblick.Nein, kein schreiendes, lustiges Signalrot, sondern ein dunkles, kupfriges, als wäre diese Erde seit altersher von Zeit zu Zeit mit Blut gedüngt worden. Das traf den Kern: Hier befand sich seit hunderten von Jahren das Zentrum des Kupferbergbaus und damit unlöslich verbunden ein traditionell bedeutendes Zentrum der Bergarbeiter beim Kampf um ihre Rechte. Ein zäher Menschenschlag, der sich hier behauptete: gewaltig und gewaltsam, voll abergläubischer Furcht vor dem unberechenbaren Berg, notgedrungen beharrlich zähe und von unbändiger Licht- und Lebensfreude. "Öbstern" war ausgleichendes Tun und zusätzlicher Gelderwerb immer gewesen. Um Eisleben herum ein Garten Eden mit Obst aller Art (nirgendwo aß ich schmackhaftere Kirschen). Plantagen von unglaublicher Fülle und Lieblichkeit. Wie mag's jetzt dort aussehn? Ob dort auch die willfährige Axt gehaust hat?
Ein extra Erlebnis wurden mir Sprache und Tonfall der Menschen aus der Eisleber Gegend. Man sagte dort beispielsweise nicht unten, sondern ungene, nicht hinten sondern hingene, überhaupt, vieles was im Hochdeutschen kurz ausgesprochen wird, wurde dort gedehnt und umgekehrt, P wie B, T wie D - hart wurde zu weich, weich zu hart. Nu, äbn: "Pißmargherink". Für mich ein ewiger Spaß. Kein Hohn.
Wiesenmarkt muß sinn
da jehn wir alle hin
Da woll'n wir keine Kläje sehn
Da woll'n wir unsrer Weje jehn
Die Tage hingerher
Da klägen wir umso mehr.
Wolfgang Landgraf: Martin Luther. Biographie. Verlag Neues Leben,
Berlin 1995, 302 S.
M Ü S S E N , D Ü R F E N U N D K Ö N N E N
Wie Frauen um ihre Menschenrechte kämpfen m ü s s
e n und daß Männer - scheinbar überall in der Welt,
wenn sie sich nicht gerade in Kriege treiben lassen - faul wie die Sünde
hohles Zeug quatschen und quatschen und quatschen und das auch noch als
höhere Philosophie verkaufen dürfen, davon erzählen diese
beiden Bücher.
Abgesehen davon, daß die notwendige Kunst der Buchgestaltung
immer mehr billigen Erwägungen der Vermarkter weichen muß, derart
etwa, daß "die Masse" eher zu wie Schmöker Aufgemachtem greift,
ist die Erzählung von Marge Piercy im Gegensatz zu dem vage bunten
Umschlag warmherzig, gut beobachtet und durchaus lesenswert geschrieben.
Unter dem ihrer Mutter gewidmeten Motto (Zeilen aus einem ihrer
Gedichte)
DIE SEHNSÜCHTE DER FRAUENläßt die Autorin die Lebenswege von ganz verschiedenen Frauen sich kreuzen. Da ist die geduldige, verständnisvolle Dozentin mit dem ewigen Seitenspringer von Ehemann, dem sie schon viel zu lange verzeiht und immer noch liebt. Da ist die Frau mit den vielen Kindern von immer neuen Liebhabern (diesmal wird alles ganz anders!).
FLÜGELSCHLAG VON FALTERN
GEGEN DECKEN
BLAUGEMALT WIE HIMMEL
Marge Piercy: Sehnsüchte. Argument Verlag 1996, 500 S.
Nuruddin Farah: Wie eine nackte Nadel. Lamuv Verlag Göttingen
1996, 334 S.
Liebe
Grafiken
Malerei
Collagen
Keramiken
Gedichte
Übersetzungen